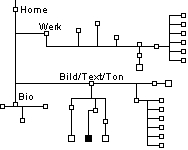In gewisser Hinsicht hat dieses Argument etwas für sich. Es bleibt aber die Tatsache, daß beispielsweise Tausende von Malern zwischen 1950 und 1960 »informell« gemalt haben, ohne daß den einzelnen Gemälden eine individuelle Handschrift, geschweige denn eine künstlerisch überzeugende Aussage abzulesen gewesen wären. Andererseits machen uns die Konzeptkünstler darauf aufmerksam, daß überzeugende künstlerische Ideen nicht in jedem Fall von ihrem Urheber vorgetragen werden müssen, beziehungsweise daß die persönliche Handschrift des Zeichners oder Malers kaum mehr als eine beliebig austauschbare Randbedingung darstellt. Einstens konnte man sich die Sache relativ leicht machen, indem man behauptete, jeder Künstler könne eben inhaltlich und formal eigenständig in Erscheinung treten, weil in der Regel Form und Inhalt sich wechselseitig bedingten. Aber man mußte doch zur Kenntnis nehmen, daß es eine formale Identität eines Künstlers geben konnte, der inhaltlich wenig zu sagen hatte; und daß andererseits weitgehende Eigenständigkeit im künstlerisch-konzeptionellen Denken durchaus auch bei relativer Konventionalität und Harmlosigkeit der Formsprache, der verwendeten Techniken und des verwendeten Materials auftreten konnte.
Heute argumentieren wir etwa so: Jeder Mensch hat seine unverwechselbare Handschrift. Wenn wir glauben, das nicht erkennen zu können, liegt das an unserer mangelnden Vertrautheit mit dem individuellen Fall. Wenn wir Laienkünstlern den unverwechselbaren Ausdrucksgestus nicht zugestehen möchten, den wir Künstlerprofis ohne weiteres zuschreiben, dann haben entweder die Laien eine nicht genügende Anzahl von Arbeiten vorgelegt, aus denen sich die individuelle Handschrift ablesen ließe, oder wir haben uns nicht genügend Zeit genommen, um den individuellen Ausdrucksgestus zu rekonstruieren. So ließe sich die Aussage verstehen, daß Künstlern, deren Identität wir »schon auf hundert Meter« wahrzunehmen behaupten, eben jene Künstler sind, mit deren hinreichend vielen Werken wir uns hinreichend häufig und hinreichend lang genug beschäftigt haben. Eine tröstliche Argumentation für all diejenigen, denen »man« keine künstlerische Bedeutung zugesteht - sie können sich sagen, daß Zeit, Umstände und Interessen ihr potentielles Publikum davon abhielten, überhaupt die Voraussetzung für eine Identifizierung zu erarbeiten. Aber diese Schlußfolgerung verlagert das Problem ja nur von der Frage »Wer ist ein bedeutender Künstler?« zur Frage »Welche Künstler werden so wahrgenommen, daß ihre Identität geläufig ist?«
Das Werk von Anna Oppermann konfrontiert uns mit einer anderen Schlußfolgerung, die zumindest gegenwärtig sehr plausibel ist. Anna Oppermann gelingt es, seit einem Dutzend Jahren mit ihren Ensemblebildungen in der gesamten veröffentlichten Kunstpraxis eine ganz unverwechselbar einmalige Position einzunehmen. Die Methode der Ensemblebildung ist dafür in erster Linie charakteristisch, obwohl gerade diese Methode keinen individuellen Urheber hat; wenn man sie denn doch auf Anna Oppermann zurückführen wollte, so wäre sie der am leichtesten verallgemeinerbare und von jedermann anwendbare Bestandteil ihrer Arbeiten.
Für mich sind die Arbeiten von Oppermann gerade deswegen so beachtenswert, weil sich die Künstlerin einer allgemein zur Verfügung stehenden Methode bedient. Aus unserer Alltagswelt können wir als Beispiel für Ensemblebildung die großen Kaufhäuser zitieren, in denen die unterschiedlichsten Waren in den unterschiedlichsten Formen, Farben und Verpackungen so miteinander ausgestellt werden, daß von jedem Käuferstandpunkt aus sowohl eine innere Logik wie eine äußere Form des Ensembles sich eröffnet: Die äußere Form eines Selbstbedienungsladens erschließt auch die größte Ansammlung unterschiedlicher Objekte so, daß sich ihnen der potentielle Käufer auf Greifdistanz annähern kann; die innere Logik rekonstruiert der Käufer entweder aus den Ordnungsangeboten auf den Hinweisschildern oder aus den Funktionszusammenhängen seines Alltagslebens.
Aus der Privatsphäre des Alltagslebens kennt jeder auch Ensemblebildungen als Hausaltäre, auf denen sich aller Plunder und alle Kostbarkeit ansammelt, die uns in Gestalt von Stoff- und Plastikfigürchen, Fotos, Postkarten, Babyschuhen etc. von den Irrfahrten unseres Lebens anschaulich Erinnerung geben oder eben den fehlenden Zusammenhang des Lebenslaufs beschwören, dem wir bei besonders herausragenden Gelegenheiten, wie den Reisen oder den Liebschaften auf die Spur zu kommen hofften.
Aus der Kunstgeschichte drängt sich als Beispiel für Ensemblebildung das Stilleben auf, sei es, daß es eine prospekthafte Inszenierung unwahrscheinlicher Begegnungen toter Dinge sein will; sei es, daß es sich als raffinierteste Augentäuschung über die Objekthaftigkeit zweidimensionaler Bilder präsentiert; sei es eine Collage von Schwitters. In diesen Stilleben wird eine Vielzahl unterschiedlicher Objekte durch Wahrnehmung, Beschreibung der Wahrnehmung und Reflexion der Wahrnehmung eines Subjekts zur Einheit des Heterogenen gebracht. Aber was ist diese Einheit: ein Ganzes, eine Summe, eine Menge, die sich selbst enthält; Ist sie Stileinheit Gleichförmigkeit? Oder durchgehende Dominanz eines Merkmals?
Auch Spoerris Fixierungen von vorgefundenen Objekten bilden Einheiten, die denen herkömmlicher Stilleben vergleichbar sind; dennoch würde kaum jemand darauf verfallen, Spoerris und Oppermanns Objektansammlungen gleichermaßen als Ensemble zu bezeichnen und sie von daher als einander sehr ähnlich zu beurteilen. Auch Armans Akkumulationen von Kannen oder Schachteln sind in bestimmbarer Weise Einheit einer Vielzahl gleichförmiger Objekte. Jedoch spürt auch der Ungeübte, daß die Oppermannschen Ensembles auf ganz anderen inneren Logiken der Objektbeziehung beruhen, beziehungsweise einer von Arman sehr verschiedenen Logik der Wahrnehmung gehorchen. Auch das sollte keine Tautologie sein: natürlich sind die Wahrnehmungen von Arman und Oppermann verschieden. Aber sind sie es tatsächlich wegen der unterschiedlichen Logiken oder nicht vielmehr durch den unterschiedlichen Gebrauch, den der jeweilige Künstler von den Logiken macht; von der Logik der Wahrnehmung, wie sie der naturevolutionäre Weltbildapparat in unseren Dickschädeln nun einmal abspult; von den Logiken, denen die Strukturen historischer Gesellschaften analog sind und die sich im Hinblick auf das Kunstschaffen im Leben kultureller Institutionen, im Aufbau von kunstinteressierter Öffentlichkeit und nicht zuletzt in der Rekonstruktion von Kunstgeschichten sichtbar werden. Der Gebrauch der Logiken könnte etwa danach unterschieden werden, ob ein Künstler, dessen Werk als Einheit des nach Form, Material, Objektcharakter, Bearbeitungsgrad Heterogenen gebildet wird (und nur von solchen ist ja in Bezug auf Anna Oppermann die Rede) - ob also diese Einheiten nur als Exemplifizierung von Logiken zustande kommen, oder ob über die Exemplifizierung hinaus auch noch die Entschlüsselung der Logiken angestrebt wird und gelingt.
»Malerei über Malerei« ist ein geläufiger Hinweis auf die in Kunstwerken erreichte Reflexivität. Für Environments oder auch Ensembles fehlt bezeichnenderweise das Kennwort für Aufklärungs- und Erkenntnisleistung durch künstlerische Arbeit. Arman exemplifiziert die Logik der Anhäufungen in seinen »Akkumulationen«. Aufschlüsse über diese Logiken enthalten sie nicht. Spoerris Fixierungen vorgefundener Objekte in subiektiv bestimmten Ausschnitten zwingen immerhin den Betrachter, zumal wenn diese Fixierungen aus der Horizontale in die Vertikale gekippt werden, danach zu fragen, welche Logik menschlicher Handlungen diesen merkwürdigen Objektversammlungen zugrunde gelegen haben, und welche Logiken den Gebrauch bestimmen, den Spoerri als Künstler von den vorgefundenen Objekten macht.
Anna Oppermanns Ensembles sind hochgradig reflexive Kunstwerke. Die Ensembles sind offenbar mehr als bloße Varianten von Ausstellungsformen, mehr als bloße Verräumlichung der Präsentation vieler einzelner grafischer Blätter. Vielleicht waren sie zunächst auch reine Environments, also »Kunstwerke, die den Betrachter räumlich umschließen«. Auf diesen Ursprung der Ensembles als Environment mag die von Oppermann bevorzugte Raumecke noch heute verweisen. In gleichem Sinne mag man annehmen, daß nur ausstellungstechnische Probleme sie daran hindern, ihre Ensembles stets als geschlossene Räume, in deren Mittelpunkt der einzelne Betrachter steht, zu präsentieren. Dennoch führt diese Vermutung in die Irre. Das wird plausibel, wenn man weiß, wie die Ensembles entstehen, beziehungsweise wenn man dazu bereit ist, den Aufbau der Ensembles in hohem Maße als Entfaltung einer inneren Logik zu betrachten.
Oppermann stellt sich einem Perspektivproblem: Muß der Rezipient die gleiche fixierte Position einnehmen, die der Künstler bezog, als er das Werk realisierte? Denn diese Realisation erfolgt ja unter experimentellen Bedingungen, die für den Rezipienten kaum gelten können. Wenn nicht, gilt dann eigentlich noch, daß der Künstler seinem Ausgangsmaterial gegenüber, also gegenüber einem Stück Welt, genau in der Weise Rezipient ist, wie der Betrachter gegenüber dem Kunstwerk - und daß die Betrachtung in gleicher Weise eine produktive Wahrnehmungsleistung ist, wie sie das Kunstwerk selbst darstellt.
Zumeist ist im Zentrum des Bildvordergrundes unmittelbar im Anschnitt noch die Künstlerin zu sehen, die an einem Tisch oder vor einem Tisch auf einem Stuhl sitzend vor sich einige Objekte betrachtet: Topfpflanze, Besteck, Tischtuch, Gardine, Schreibgerät, Handspiegel, Früchte. Auch in den späteren Ensembles bleibt im Grunde diese Ausgangslage als Perspektivproblem gegenwärtig. Die Problemstellung lautet: Wie kann es selbst einem künstlerisch ausdrucksfähigen Subjekt gelingen, die vielfältigen Annäherungen an ein Stück Welt, die mit den unterschiedlichsten Methoden und Techniken vorgetragen werden, zu einem Bild von, zu einer Erkenntnis über, zu einer Aneignung des Stückchen Welt zusammenzufügen?
So sehr sich auch Kubisten, Futuristen, Surrealisten bemühten, diese Leistung durch Tafelbildmalerei zu erreichen: die Malerei erreicht ihre Leistungen doch immer nur durch Einschränkungen der Wahrnehmungsformen, der Perspektivvielfalt, der Methodenvarianz, des Materialwechsels. Auch Anna Oppermann wollte sich diesem Zwang nicht beugen. Wenn ein Tafelbild unter Vorherrschaft einer Wahrnehmungsform nicht ausreicht, dann wollte sie eben versuchen, viele unterschiedliche Tafelbilder miteinander so zu versammeln, daß sie durch wechselseitige Bezüge die zwangsläufige Beschränktheit jedes Einzelnen weitgehend aufhoben. Man kann freilich auch für die Entstehung des normalen singulären Tafelbildes manchmal ein solches Vorgehen voraussetzen, wenn man etwa annimmt, daß der Künstler eine Vielzahl von Skizzen anfertigt, die er dann zwangsläufig nur in einer Hinsicht auswertet und realisiert. Bei Anna Oppermann erhalten die Skizzen vielfältiger Wahrnehmungen eines Segments »Welt« Eigenständigkeit, sie werden zu selbständigen Größen aufgewertet, ihr Wechselbezug wird nicht in einem definitiven Sinne endgültig in eine verbindliche Tafelbildformulierung überführt. Die Räumlichkeit des Oppermannschen Ensembles wird durch den Aktionsspielraum des Künstlers oder Rezipienten definiert; die räumliche Struktur ist sowohl durch den Zeitpunkt der Entstehung einzelner Ensembleelemente bestimmt (in unmittelbarer Nähe zur zeichnenden, malenden Hand stehen die frühesten, weiter entfernt die späteren Arbeiten); andererseits wird die räumliche Struktur des Ensembles aber auch nach einfachen Gesichtspunkten der Wahrnehmbarkeit ausgelegt (die kleinstteiligen Elemente im Vordergrund, die großflächigen im Hintergrund). Auf jeden Fall vollzieht sich die Annäherung, die Wahrnehmung, die Entschlüsselung und die Aneignung in einem mehr oder weniger der eigenen Erkenntnisdynamik entsprechenden Wechsel von Detail und Totale, im Wechsel von unvermittelter und vermittelter Objektrepräsentanz (z. B. durch Spiegel); durch Austausch von Originalobjekt und zeichenhafter Repräsentanz des Objekts, nachdem es in viele perspektivische Ansichten zerlegt worden ist, so daß Aufsicht und Untersicht und Seitenansicht des Ausgangsobjekts gleichzeitig aber aus verschiedenen Distanzen und in unterschiedlichen Techniken der Wiedergabe möglich werden.
Nachdem auf diese Weise einige Arbeitsschritte absolviert sind, verschafft sich Anna Oppermann durch eine fotografische Totale den Überblick, der seinerseits in das Ensemble aufgenommen wird, und aus dem sich bisher vielleicht noch unbewußte Schwerpunktbildungen zum Thema oder unbemerkte Vorlieben für eine einzelne Technik ablesen lassen, um sie gegebenenfalls zu kontern oder produktiv auszunutzen. Man kann durchaus sagen, daß dieser Arbeitsprozeß prinzipiell weitestgehendst unbegrenzt sein könnte, daß er aber in jedem konkreten Fall durch Ausschöpfung des Aktionspotentials der Künstlerin, oder Erschöpfung ihrer Neugier, oder fruchtlose Wiederholung, wie auf der anderen Seite durch Grenzen des Materialaufwandes, der Präsentationsfläche, der zur Verfügung stehenden Arbeitszeit doch ein Ende finden muß.
Natürlich wird man sich am jeweiligen Ensemble Oppermanns fragen, ob innerhalb der gegebenen Grenzen tatsächlich das Thema oder die Problemstellung hinreichend abgearbeitet worden sind. Hier nun kommen wir dem eigentlichen Kern des Oppermannschen Vorgehens auf die Spur. Dieses Vorgehen kennt kein Scheitern vor Aufgabenstellungen, wie sie den klassischen Verfahren der künstlerischen Bearbeitung von Aufgaben nur allzu häufig drohen. Oppermanns Differenzierungen nach Konfrontationsdistanzen (ganz nah, halbnah, dreiviertel, total), die Differenzierung nach Techniken, nach Formaten, nach Farbcharakteren (Lokalfarbe, topografische Farbe, psychologische Farbe), die Differenzierung nach textlicher und bildlicher Repräsentanz, nach Beschreibung, Analyse, assoziativer Erweiterung - alle diese jeweils zustande gebrachten Unterscheidungen tragen ihren Sinn bereits in sich. Aus der gegenwärtig gehaltenen Unterscheidung lassen sich in jedem Fall Bedeutungen rekonstruieren, denn die Bedeutung ergibt sich ja immer aus dem Faktum der Unterschiedenheit.
Oppermann ist also in hohem Maße als Künstlerin auf ähnliche Begründungszusammenhänge des eigenen Tuns ausgerichtet, wie es Wissenschaftler sind. Negativ, aber deutlich ausgedrückt, würde das heißen, daß man ihr wie dem sprichwörtlichen Wissenschaftler zwar die ungeheure Differenzierungsleistung anerkennt, aber sofort nachfragt, wozu denn die ganze ungeheuerliche Unterscheidungsarbeit gut sein soll, wohin sie führt. Nun, da eben haben wir unsere normalen Identifikationen künstlerischer Persönlichkeiten und ihrer Werke doch erheblich zu erweitern. Wenn wir auch nur als eine Möglichkeit zulassen, daß der Sinn des künstlerischen wie wissenschaftlichen Tuns in der Ausbildung der Unterscheidungsfähigkeit selber liegt, und daß diese Differenzierungen möglichst gleichzeitig zugänglich gemacht werden (das ist das Ensemble von Anna Oppermann), dann wird uns die Identität eines Künstlers als Beispielhaftigkeit seines Tuns verständlich. Wir sind nicht aufgefordert, in seinem Können die ungeheure Distanz zwischen uns und seinem Können durch Bewunderung zu überbrücken beziehungsweise erträglich zu machen; wir sind auch nicht aufgefordert, ihn nachzuahmen in einer Art unverantwortlicher Euphorie des do it yourself; vielmehr wird uns bewußt, was aus in uns allen steckenden Voraussetzungen zu machen ist, in welchem und in wie umfassendem Sinn unsere Weltaneignung gelingen kann. Dabei führt uns keine Wahrheit, verpflichtet uns kein Glaubenssatz, zwingt uns keine höchste Liebe, die nicht aus einer je besonderen Unterscheidungstätigkeit hervorginge. Wenn wir uns aus den Klauen der Obsession, aus den Fesseln des Dogmas und der stillen Selbstzensur befreien wollen, dann ausschließlich durch das Training der Differenzierungsfähigkeit auf allen jenen Wahrnehmungs- und Tätigkeitsstufen, die uns ein fähiger Künstler wie Anna Oppermann in ihrem Werk vorführt. Aufklärungs- und speziell Erkenntnisleistung des Ensembles liegen darüber hinaus in der gleichzeitigen Präsentation alternativer, sich wechselseitig relativierender, aber darin auch erst begründender Bedeutungszusammenhänge.
[